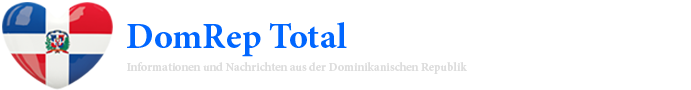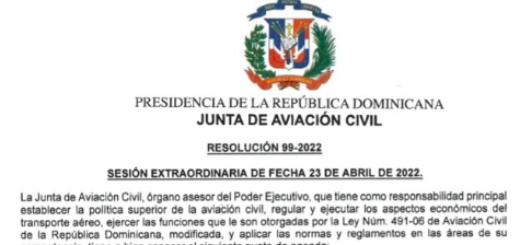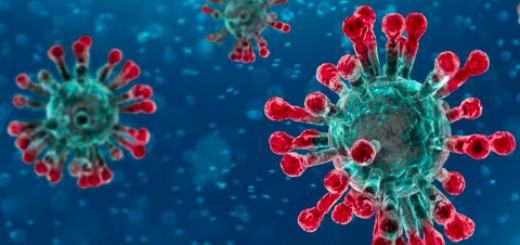In den letzten Tagen (Stand Okt. 2025) gingen Videos mit Interviews mit Menschen unterschiedlichen Alters während der traditionellen Feierlichkeiten zum Tag des Heiligen Erzengels Michael am 29. September in der Kirche, im Park und im nach dem Heiligen benannten Stadtteil der Kolonialstadt Santo Domingo in den sozialen Netzwerken viral. In Videos und Bildern, die von verschiedenen Medien verbreitet wurden, drückten Gläubige und Anhänger ihre Verehrung, Liebe und ihren Glauben an den kriegerischen Erzengel aus, allerdings aus der Perspektive des dominikanischen Voodoo, das viele als Volksreligion und 21. Division bezeichnen, wo San Miguel als Wesen mit Belié Belcán Toné, dem Beschützer und Verteidiger des Guten, verschmolzen ist.
Das Interessante an den Videos war die Selbstverständlichkeit, mit der die Teilnehmer, darunter auch Mitglieder der LGBTQ-Gemeinschaft, über ihre Verbindung zum Mysterium sprachen und erzählten, wie sie seinen Altar vorbereiten, Kerzen anzünden, ihm Salve-Lieder singen, auf Stöcken oder Trommeln spielen, ihm Kekse und Süßigkeiten als Gelübde bringen, um sie dann mit den Tausenden von Gläubigen und Neugierigen zu teilen, die jedes Jahr aus dem ganzen Land und aus dem Ausland zu dieser ganztägigen Feier kommen.
Die Menschen brachten zum Ausdruck, wie sehr sie einen der beliebtesten und verehrtesten Heiligen des Landes schätzen, indem sie sagten, dass sie ihn in ihrem Alltag als nah empfinden und dass er ihre Bitten erfüllt, weshalb sie jedes Jahr zur Feier kommen, um ihre Versprechen einzulösen oder zu bezahlen. Aus anthropologischer Sicht ist es wichtig festzuhalten, dass dieser Ort oder dieser Sektor an diesem Tag zum wichtigsten und bevölkerungsreichsten Zentrum der Feierlichkeiten zu Ehren des Heiligen in ganz Lateinamerika wird.
An diesem Tag lebt das dominikanische Volk seinen Glauben ohne Angst, ohne Schuldgefühle, mit Freude und Freiheit: Sie kleiden sich schon früh morgens in Rot oder Grün, um zur Arbeit zu gehen, sie teilen Bier und Kekse, sie posten Bilder und Gebete des Heiligen in den sozialen Netzwerken, man hört Salve-Gesänge und Trommelklänge sogar in den Autos, wenn diese mit heruntergekurbelten Fenstern durch die Straßen fahren, was die Stadt in ein Volksfest voller Spiritualität und Widerstandskraft verwandelt.

Meiner Meinung nach sollte der 29. September zum Feiertag und Nationalfeiertag des Landes erklärt werden, wie es in anderen Ländern der Fall ist, denn San Miguel oder Belié Belcán ist auch der Schutzpatron der Nationalarmee mit dem Rang eines Kommandanten und wird für sein Beispiel an Mut, Gerechtigkeit und Stärke verehrt, Tugenden, die unsere Soldaten inspirieren.
Dies ist ein Ausdruck der dominikanischen Kultur, der bis in die Kolonialzeit zurückreicht und den Schutz und die spirituelle Führung für die Soldaten bei ihrer Mission zum Schutz der Souveränität und Sicherheit der Nation symbolisiert. Aus diesem Grund wird ihm am frühen Morgen des 29. September in einer der Messen, die in Anwesenheit der Soldaten in der von Afrikanern in der Kolonialzeit erbauten Kolonialkirche gefeiert wird, Ehre erwiesen.
San Miguel ist für die dominikanischen Streitkräfte so wichtig, dass es eine nach ihm benannte Pfarrei im Militärlager 16 de Agosto gibt, dem Sitz der Ersten Infanteriebrigade der dominikanischen Armee. An diesem Tag wird eine besondere Messe gefeiert, die vom Erzbischof von Santo Domingo, der auch einen militärischen Rang innehat, zelebriert wird und an der der amtierende Verteidigungsminister, die obersten Militär- und Polizeibeamten sowie die Mitglieder der verschiedenen Generalstäbe des Landes teilnehmen.
Ursprünge und Wurzeln einer gegenwärtigen Spiritualität
Angesichts dieser Feier, die jedes Jahr in der dominikanischen Gesellschaft an Bedeutung gewinnt, insbesondere bei den jüngeren Generationen, die trotz des vorherrschenden Diskurses des Hasses und der Ablehnung dieser alten Bräuche ihre verleugnete Identität annehmen, habe ich mich dafür interessiert, darüber nachzudenken, wohl wissend, dass es zu diesem Thema zahlreiche Analysen und Untersuchungen aus unterschiedlichen Blickwinkeln gibt. aber da sich alles verändert, müssen wir weiter über die Veränderungen nachdenken und sie systematisieren, damit sie Bestand haben.
Wie Luis Peguero in ¿Vudú dominicano o vudú en Santo Domingo? (2000) erwähnt, ist seit den 1970er Jahren eine Zunahme von Fachstudien über das religiöse Verhalten unseres Volkes zu beobachten (Patín, 1974; Rosernberg, 1973; Deive, 1975: Jiménez, 1981; Rodríguez, 1982, Davis, l987; u. a.), die einen wichtigen Trend hervorbringen, der den „dominikanischen Voodoo” als den allgemeinsten und repräsentativsten Ausdruck unserer magisch-religiösen Welt darstellt.
Um die Präsenz des Voodoo im dominikanischen Alltag zu verstehen, muss man bis zur Kolonialisierung zurückgehen. Wie der Historiker Frank Moya Pons (2013) unter Berufung auf seine Forschungen und unter Verweis auf Primärquellen wie die Chronisten der Indias erklärt, gab es bei der Ankunft Kolumbus‘ auf der Insel im Jahr 1492 etwa 400.000 Taíno, fünfzehn Jahre später jedoch nur noch etwa 60.000 übrig waren, die meisten von Hunger gestorben oder in den Minen versklavt. Auf diesen ersten Völkermord folgte ein noch grausamerer: der Handel mit Millionen von Afrikanern, die gewaltsam herbeigeschafft wurden, um die indigene Arbeitskraft zu ersetzen.
Diese Männer und Frauen wurden alles genommen: ihre Familien, ihre Sprachen, ihr Land und ihren Glauben. Die Kolonialisierung zwang ihnen die „christliche Zivilisation” auf und versuchte, die afrikanischen Religionen auszulöschen. Aber die spirituelle Erinnerung hielt stand. Die Versklavten vermischten katholische Symbole und Heilige mit ihrer Weltanschauung und afrikanischen Gottheiten und verwandelten die Unterdrückung in das, was wir heute als religiösen und kulturellen Synkretismus kennen. So entstanden die „Geheimnisse” des dominikanischen Voodoo, die in den Höfen, in den Bergen, in den Wäldern, in den Höhlen, in den Zimmern, in den Volksgebeten, in den Gebeten, den Salve-Gesängen, den Trommelklängen, den Flaschen mit Blättern und Wurzeln, im Wissen und in den heimlich errichteten Hausaltären überlebten.
In „Voces del Purgatorio, estudio de la salve dominicana” (1981) vertritt die Anthropologin Martha Ellen Davis die Ansicht, dass die dominikanischen Bestattungsriten Elemente der afrikanischen Weltanschauung bewahren. In ihnen ist der Tod kein Bruch, sondern Kontinuität; die Toten bleiben präsent und begleiten die Lebenden. Davis beobachtet, dass Praktiken wie „dem Toten Essen geben”, Gebete mit Kerzen und Rum und Salve-Gesänge Ausdruck einer angestammten Spiritualität sind, die Katholizismus und afrikanische Traditionen miteinander verbindet.
Voodoo ist also kein isoliertes Phänomen: Es drückt sich in der Musik, in der Volksmedizin, in Gebeten, in Versprechen, in der mündlichen Überlieferung und in Träumen aus. Wie Enrique Patín Veloz (1981) in „El vudú y sus misterios” (Voodoo und seine Geheimnisse) treffend feststellte, „ist Voodoo ein Bestandteil der dominikanischen kulturellen Identität, keine marginale oder fremde Religion, sondern eine Form, die Welt und das Heilige aus den afrikanischen Wurzeln des Volkes heraus zu begreifen, wo es eine Präsenz zwischen Leben und Tod gibt”.
Ebenso dokumentiert Carlos Esteban Deive in „Vudú y magia en Santo Domingo” (1979) akribisch, wie Voodoo-Praktiken, zu denen der Gebrauch von Kräutern, Amuletten, Gebeten und Altären gehören, von den kolonialen und republikanischen Eliten kriminalisiert wurden, obwohl sie ein komplexes Glaubenssystem darstellten, das Medizin, Kunst, Musik und Weltanschauung umfasste. Deive behauptet, dass „die afro-dominikanischen Glaubensvorstellungen ein untrennbarer Bestandteil des Lebens der Menschen sind, eine religiöse Sprache, die die Dominikaner unbewusst verwenden, um mit ihrer spirituellen Welt zu kommunizieren”.
Voodoo als alltägliche Praxis in der Dominikanischen Republik
In der Dominikanischen Republik ist Voodoo nicht nur eine Religion, sondern eine Lebensweise. Es findet sich in Hausmitteln, in den „Flaschen”, die Heilkundige zubereiten, in den Gebeten der Hebammen, in den Familienaltären, in den Farben und Symbolen der Eisen, die die Häuser schmücken, in den Träumen, die Veränderungen oder Unglück ankündigen, im Trommelschlag und im Gesang der Salven.
Es ist kein Zufall, dass so viele Dominikaner Namen wie Candelaria, Miguela oder Miguel, Isa, Martha, Tata, Liborio oder Elías, Carlos usw. tragen, zu Ehren von Heiligen, Schutzpatronen und Lobpreisungen, die das Zuhause beschützen. Diese Namen sind mehr als nur Tradition: Sie sind Glaubensbündnisse, Versprechen und spirituelles Erbe, das Familien mit ihren Vorfahren verbindet. Wie Carlos Esteban Deive (1985) betonte, war und ist Voodoo „die stillste Form des kulturellen Widerstands der schwarzen Bevölkerung der Dominikanischen Republik”, eine Sprache der Erinnerung, die es ermöglichte, die Verbindung zu Afrika inmitten von Kolonialismus und Ausgrenzung aufrechtzuerhalten.
Die Ausübung des Voodoo ist eine lebendige Spiritualität, die das soziale, wirtschaftliche und emotionale Leben der Bevölkerung durchdringt. Im dominikanischen Alltag verschmilzt Voodoo mit dem täglichen Leben: Der Dominikaner mag leugnen, „davon” zu sein, aber wenn er eine Kerze anzündet, wenn er mit den Toten spricht, wenn er ein Glas Wasser auf den Altar stellt oder wenn er San Miguel oder Anaisa bittet, ihm „die Wege zu öffnen”, reproduziert er eine afrikanische spirituelle Erinnerung an die voodooistische Weltanschauung, die sich weigert zu sterben.
In einer Gesellschaft, in der religiöse Vorurteile nach wie vor bestehen, muss dringend anerkannt werden, dass Voodoo weder böse noch teuflisch ist, wie uns gelehrt wurde und oft aus Unwissenheit, Intoleranz, Verleugnung oder einfach aus Missachtung religiöser Praktiken behauptet wurde. Es handelt sich um eine spirituelle Praxis, die nach Ausgeglichenheit, Schutz und Wohlbefinden strebt. Sie ist Teil des immateriellen Kulturerbes der Dominikanischen Republik und unserer afro-stämmigen Identität.
Wir haben bereits in vielen unserer in dieser Kolumne und anderen Interaktionsräumen veröffentlichten Überlegungen zum Ausdruck gebracht, dass im Zentrum des Voodoo Gott steht, genannt Bondye, der höchste und transzendente Schöpfer des Universums. Bondye (aus dem Französischen: Bon Dieu, wörtlich: Guter Gott) ist laut der Voodoo-Religion derjenige, mit dem die Praktizierenden über zwischengeschaltete Wesenheiten namens Loa interagieren, Geister, die sie anrufen, um Hilfe in alltäglichen Angelegenheiten zu erbitten. Bondye ist einfach die „göttliche Barmherzigkeit”, der Ursprung der Schöpfung, und die Loas sind die Vermittler zwischen dieser höheren Gottheit und der irdischen Welt. Der Voodoo gehört zu den ältesten Religionen der Welt, wie Alfred Metreux in seinem ikonischen Werk Voodoo (1979) berichtet.
Deshalb müssen wir die Gesetze respektieren, die die Religionsfreiheit garantieren, und jedem Menschen erlauben, seinen Glauben in Frieden und ohne Angst zu feiern, sei es in einer Kirche oder an einem Hausaltar. Der Voodoo als Ausdruck des Widerstands und der Liebe zu den Vorfahren begleitet das dominikanische Volk seit der Sklaverei bis heute, hat sich wie jede andere Ausdrucksform gewandelt und Zensur, Vorurteile und Vergessenheit überlebt.
Die Kirchen oder die Mächtigen mögen es weiterhin leugnen, aber Voodoo ist in allem präsent: in der Musik, in der Sprache, in der Medizin, in den Träumen, auf den Altären und im Herzen des Volkes. Denn, wie ein alter Gläubiger aus Belié Belcán sagen würde: „Voodoo lebt in der Seele der Dominikaner, auch wenn sie es nicht sagen.“ Bis nächste Woche. (acento)